Schubladenkunst oder die Erfindung des Halbtons

Schubladenkunst oder die Erfindung des Halbtons
Ein dichtes graues Gewebe überspannt den Himmel. Manchmal ein lichteres Stück, ganz so, als würde hinter diesem Himmelsvorhang eine Theateraufführung stattfinden, die sich unseren Blicken entzieht, weil wir auf der falschen Seite stehen. Kaum, dass unsere Aufmerksamkeit sich am Grau zu erschöpfen droht, taucht wieder ein Licht auf; der schwache Schein einer Lampe, die dicht hinter dem Tuch geführt wird. Die Akteure dieses Stückes bleiben uns unbekannt, aber diese Ahnung von Licht lässt uns hoffen, dass der Vorhang bald aufgezogen wird.
Diese Zeilen schrieb ich vor einigen Jahren in ein Notizbuch. Wir saßen im tiefergelegten niederländischen Friesland, in das wir uns zwecks Himmel-, Erd- und Wasserbeobachtung zurückgezogen hatten. Was mich diese Sätze jetzt aufgreifen lässt, ist die darin enthaltene Abwesenheit von Präsenz. Dabei ist das, was nicht sichtbar ist, meist das Wichtigste. Im übertragenden Sinn gilt dies auch für die künstlerische Druckgrafik. Zumindest für den, der sie erstellt. Während der Betrachter im Endergebnis ein Blatt Papier mit einem Motiv in Händen hält, ist es für den Hersteller ein langer und aufwendiger Weg, der je nach Technik auch viele Möglichkeiten des nachhaltigen(dieses Wort wollte ich einfach auch einmal in einem Text unterbringen) Scheiterns bietet, weil Korrekturen sehr schwierig oder gar ausgeschlossen sind. Vor allem aber wird ein Ergebnis tatsächlich erst am Ende des ganzen Prozesses sichtbar, vorher arbeitet man an einem Überraschungspaket, dessen Inhalt man erahnt, aber noch nicht wirklich überschauen kann. In Zeiten der digitalen Pixelbilder, mit denen jeder ein Künstler sein darf, der es nur oft genug selbst betont, muss über noch etwas gesprochen werden, weil es gerade für die Druckgrafik unabdingbar ist: Man nennt es Handwerk. Also nichts für diejenigen, die so gerne über das Brechen von Regeln fabulieren, ohne auch nur eine einzige dieser Regeln zu kennen.
Obwohl in den letzten Jahren so etwas wie eine Renaissance der künstlerischen Druckgrafik stattgefunden hat, darf man wohl konstatieren, dass diese vielfältige und eigenständige künstlerische Bildwelt schon bessere Zeiten gesehen hat. Für Dürer oder Cranach waren es noch lukrative Geschäftsfelder, ihre Holzschnitte an eine breitere Käuferschicht zu verticken. Allerdings waren dies auch relativ bilderlose Zeiten, in denen es bestenfalls in der Kirche ein Altarbild zu bewundern gab, und vielleicht, wenn man einen Kumpel besuchte, der beruflich als Landgraf oder König tätig war und sich so quasi per Amt einen Maler unterhielt, der ihn mit bunten Bildern bei Laune hielt. Das gemeine Volk war in der Regel ohne Bilder und ausreichend froh darüber, wenn über dem Feuer ein Topf mit Kohlstrünken köchelte. Mit dem Aufkommen einer breiteren Bürgerschicht, die sich weniger Sorgen um den Inhalt ihres Kochtopfes machen musste, wuchs auch die Lust auf Bilder, die Himmel, Hölle, Erlösung und die restliche Welt abbildeten. Ein guter Nährboden für die „Schwarze Kunst“, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte vom Handwerk der Bildvervielfältigung zur freien künstlerischen Ausdrucksweise entwickelte. Als Dürer 1515 seinen Holzschnitt „Rhinocerus“ anfertigte und sehr erfolgreich vertrieb, war der freie künstlerische Ausdruck kein Thema, man wollte ein Abbild der Realität in einer Welt, die dem Einzelnen noch sehr unbekannt war, ob es nun die Ansichten ferner Städte oder seltsamer Pflanzen aus Surinam waren. Es ging dabei um größtmögliche Kunstfertigkeit und nicht um Kunst, wie wir sie heute verstehen. Dass Dürer fast „tagesaktuell“ auf ein Ereignis reagierte (das Tier gelangte 1515 von Indien nach Lissabon und war natürlich eine Sensation in Europa, in dem die Wildsau oder der Braunbär das Maß aller tierischen Dinge waren) darf man seiner Geschäftstüchtigkeit bewundernd zuschreiben. Dürer, der das „Rhinocerus“ nie mit eigenen Augen sah und das Bild nach Berichten und Skizzen eines unbekannten Künstlers fertigte, bestimmte bis ins 18. Jahrhundert hinein unser Bild eines Nashorns. Es wundert nicht, dass immer neue Auflagen dieses Bildes gedruckt wurden, neben unzähligen Kopien, die fleißige Kunsthandwerkerhände anfertigten. Bildernahrung für’s Volk, das noch ein paar hundert Jahre auf zoologische Gärten warten musste, in denen man ein Nashorn betrachten konnte. Dürer hätte vermutlich niemals diese breite Bekanntheit und Wertschätzung bis in unsere heutige Zeit ohne seine grafischen Arbeiten erlangt. Es gibt viele Beispiele, die bis in die Neuzeit reichen, wo Künstler ihre Popularität der grafischen Kunst, der Reproduzierbarkeit ihres Werks in Form von Holzschnitten, Stahlstichen, Radierungen oder Lithografien verdanken. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass man viele dieser Künstler überhaupt nicht kennen würde, wenn nicht irgendein Hansel mal bewusst, mal eher zufällig eine Technik entdeckte oder weiterentwickelt hätte, die heute unter den Kategorien Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck und Durchdruck zu finden sind. Oft waren es aus unserer heutigen Sicht Amateure, die wahre Quantensprünge in den druckgrafischen Techniken ermöglichten. Viele von ihnen sind in der Vergessenheit verschwunden. Oder kennt jemand zufällig Ludwig von Siegen?
Ok, man muss ihn nicht kennen, aber ihm verdanken wir im Jahre 1642 die Erfindung des Halbtons in der Druckgrafik. Bis dato war es nicht möglich, Halbtöne, wie wir sie etwa aus Zeichnungen oder Ölbildern kennen, druckgrafisch wiederzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt basierten alle gängigen druckgrafischen Verfahren (Holzschnitt, Kupferstich, Ätzradierung) auf der Wiedergabe von Linien. So etwas wie Halbtöne wurden in der Regel durch unterschiedlich dichte Schraffuren, also durch überkreuzende Linien, imitiert.
(Hier ist ein kleiner Einschub notwendig, weil manchmal bei komplexeren Themen Grundlagen zum besseren Verständnis erklärt werden müssen. Leute, die sich auskennen, werden das für völlig überflüssig halten (also ich), aber die winzige Minderheit der Ahnungslosen soll nicht auf dem Schlauch stehen, wenn sie gewillt sind, den Ausführungen weiter zu folgen. Die Auskenner können jetzt eine Pinkelpause machen.
Da es im Text um manuelle künstlerische druckgrafische Techniken geht, ist es notwendig, einige grundsätzliche Anmerkungen zu machen. Wenn wir einige hundert Jahre zurückgehen, gibt es nur zwei Kategorien der Druckgrafik, also der Möglichkeit, Bilder zu drucken: Hochdruck und Tiefdruck. Die Unterschiede erkennt man schon im Namen. Beim Hochdruck sind alle druckenden Teile einer Druckform erhaben gegenüber den tieferliegenden nichtdruckenden Teilen. Der klassischste künstlerische Hochdruck ist der Holzschnitt. Es ist eine einfache Geschichte, man denke sich eine Holzplatte, in deren Oberfläche mit dem Taschenmesser ein fettes Herz nebst Initialen der Liebsten (der Romantiker kennt das von Bäumen) geschnitzt wird. Wer nun die Oberfläche dieser Holzplatte mittels einer Walze mit Druckfarbe einfärbt, ein Blatt Papier darüber legt und das Ganze vorsichtig abreibt, anschließend das Papier ebenso vorsichtig abzieht, wird feststellen, dass er nun auf das Papier eine schwarze Fläche gedruckt hat, mit einem fetten weißen Herz mittendrin. Außerdem wird er betroffen feststellen, dass seine geschnitzten Initialen nun spiegelverkehrt auf dem Blatt Papier auftauchen. Gut, so etwas passiert. Führt aber zu einem Grundsatz, der fast überall seine Gültigkeit hat: Erst nachdenken, dann machen!
Ungleich schwieriger verhält es sich mit dem künstlerischen Tiefdruck.
Die Druckform ist in der Regel aus Metall, das sich nicht so leicht wie Holz bearbeiten lässt. Wer sich schweren Herzens doch dafür entscheidet, mit vielen Mühen auf Kupfer- , Zink- , oder Eisenplatten herumzukratzen, hat dafür eine größere Palette an Ausdrucksmöglichkeiten, als ihm dies der Hochdruck bieten würde. Grundsätzlich lassen sich beim künstlerischen Tiefdruck alle Verfahren der Druckform-Bearbeitung in zwei Gruppen unterteilen. Zum Einen spricht man von „kalten“ oder „trockenen“ Verfahren. Darunter fallen alle Arten der Bearbeitung, in denen mit einem Werkzeug direkt die blanke Metallplatte bearbeitet wird. Als Beispiele, die fast jeder schon einmal gehört hat: Der „Kupferstich“ oder die Bezeichnung „Kaltnadel“. Zum Anderen gehören, die „warmen“ oder „nassen“ Verfahren. Die darunter fallenden Techniken zeigen vor allem eines: Säure hinterlässt im Metall tiefe Spuren, und sie kribbelt an den Fingern, wenn man sie nicht rechtzeitig mit Wasser abspült. Die Ergebnisse dieser alchemistischen Versuche nennt man dann z. B. „Radierung“ oder „Aquatinta“. Jedenfalls, wenn es klappt. Denn Löcher, Linien, Punkte oder Kratzer im Metall zu haben , ist die eine Sache, eine andere ist es, sie auf Papier abzudrucken. Beim Tiefdruck liegen, im Gegensatz zum Hochdruck, alle druckenden Teile vertieft in der Metallplatte, was die Sache nicht einfacher macht. In der Praxis sieht das so aus: Die gesamte Oberfläche der Druckplatte wird mit Tiefdruckfarbe, in der Regel ist das eine relativ zähe Pampe, eingefärbt. Dann beginnt man damit, die Metallplatte an der Oberfläche wieder blank zu wischen, und zwar so, dass die Farbe in den Vertiefungen, also unseren Löchern, Linien, Punkten und Kratzern zurückbleibt, die Oberfläche aber blank und ohne Druckfarbe ist. Das klingt kompliziert, was sicherlich auch daran liegt, dass es kompliziert ist. Auch ein guter Druckgrafiker kann hier untergehen, wenn er nicht ein mindestens ebenso guter Drucker ist. Die vorbereitete Platte muss nun auch gedruckt werden. Was beim Hochdruck, einem Holzschnitt zum Beispiel, noch einigermaßen gut am heimischen Küchentisch gemacht werden kann, erfordert nun eine Tiefdruckpresse. Wir brauchen nämlich ordentlich Druck. Die vorbereitete Metallplatte wird plus dem daraufliegenden Papier durch zwei Metallwalzen gedreht. Durch den hohen Pressdruck wird die Druckfarbe aus den Vertiefungen der Metallplatte auf dem darüber liegenden Papier abgedruckt. Wenn tatsächlich alles geklappt hat, hält man jetzt ein bedrucktes Blatt Papier in Händen. Der Sinn von Druckgrafik liegt in der Vervielfältigung. Für jeden einzelnen Druck ist dieser Aufwand zu betreiben, d. h. Platte einfärben, Oberfläche blank wischen, drucken. Um es einmal zeitlich zu fassen: Je nach Größe der Druckplatte oder der Schwierigkeit, die manche Techniken oder Motive beim Blankwischen der Platte mit sich bringen, kann ein einzelner Druck schon mal eine Stunde beanspruchen. Bei einer „einfachen“ Druckplatte in überschaubarer Größe sind kaum mehr als 4 Drucke pro Stunde möglich. Wohlgemerkt rede ich hier nur vom Druck, die eigentliche künstlerische Leistung, das Motiv, und insgesamt die Herstellung der Druckform ist hier noch gar nicht berücksichtigt. Also nicht beschweren, wenn man auch ein paar Euro für eine Originalgrafik ausgeben muss! Für den Künstler heißt es oft genug: Viel Aufwand und wenig Ertrag. Ok, für die Auskenner ist die Pinkelpause zu Ende, es geht weiter im Text).
Oh, wo war ich stehengeblieben?
Beim klassischen Hochdruck, einem Holzschnitt, ist es bis heute so, dass zwar Farbflächen, aber keine Halbtöne gedruckt werden können. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht aufschreien, weil er erst kürzlich über einem wunderbaren und vielfach publizierten Farbholzschnitt des Japaners Hokusai meditiert hat. Den Farbholzschnitt „Die große Welle vor Kanagawa“ wird fast jeder einmal gesehen haben, ein beliebtes Motiv für so ziemlich jeden Zweck und Kontext. Er zeigt, wie sollte es anders sein, eine Welle, die gekonnt aus unterschiedlichen Farbflächen aufgebaut ist, aber ... im Hintergrund ist am dargestellten Himmel ein Farbverlaufzu bewundern, also Halbtöne. Wie jetzt? Geht Halbton doch im Holzschnitt? Nö! Aber man kann natürlich immer in die Trickkiste greifen. So wie Hokusai. Die Halbtöne, der Farbverlauf, ist nicht auf der Druckplatte, sondern wird individuell mit der Druckfarbe darauf aufgebracht. Im Ergebnis heißt dies: Wenn man die Druckplatten einfach einem Drucker in die Hand gegeben hätte, druck mal, wäre an Stelle des Verlaufs eine einfache Farbfläche zu sehen. Durch diese individuelle Einfärbung wird sich jeder Druck auch ein wenig vom anderen unterscheiden. Wenn man so will, ist das eine andere Form der Handkolorierung.
Zu Dürers Zeiten gab es bei den Tiefdruckverfahren, beschränkt auf Kupferstich und Ätzradierung, wie schon erwähnt keine Halbtöne, die mussten noch erst erfunden werden. Es war nicht einmal möglich eine einfache schwarze Fläche zu drucken, wie dies beim Holzschnitt ohne Probleme machbar ist. Kupferstich und Ätzradierung waren gänzlich auf die Linie angewiesen, und die dunkelste Fläche bestand aus sich vielfach überkreuzenden Linien. Auch heute, wo der Halbton längst auf der Welt ist und damit Flächen und Verläufe gedruckt werden können, ist beispielsweise eine tiefschwarze Fläche im Tiefdruck immer eine Mischung aus druckenden und nichtdruckenden Teilen. Vereinfacht erklärt liegt es daran, dass die Druckfarbe in den Vertiefungen der Druckplatte einen gewissen Halt braucht, um nicht schon vor dem Druck herausgewischt zu werden (wir erinnern uns: Platte putzen).
Nicht leicht ist es, sich in die Köpfe des 17. Jahrhunderts zu katapultieren. In dieser Zeit gab es viele neue Erkenntnisse, mit der sich Naturwissenschaft und Philosophie die Zeit vertrieben. Eine dieser Erkenntnisse war, dass eine Linie nicht einfach eine Linie ist, sondern aus einer Unmenge an Punkten besteht. Ebenso wie eine Fläche, die durchaus nicht so homogen und gleichmäßig ist, wie sie optisch erscheint. Uns mag so etwas wie das kleine Einmaleins erscheinen, aber damals waren solche Erkenntnisse jedoch völlig neu und revolutionär.
Ludwig von Siegen (1609-1680) war alles andere als revolutionär. Er war ein Offizier, der unter verschiedenen Fürsten diente. Nicht sonderlich ungewöhnlich in einer Zeit, in der ein dreißigjähriger Krieg Europa verwüstete. Während der Krieg tobte, war von Siegen nicht permanent mit Hauen und Stechen beschäftigt, na ja, irgendwann wurde halt auch die Bevölkerung knapp. Zwischenzeitlich bekam er eine Anstellung als Zeichenlehrer von Wilhelm von Hessen, dem Sohn der damaligen Landgräfin von Hessen-Kassel. 1642 hatte von Siegen die gute, aber auch relativ zeitaufwendige Idee, nämlich eine Kupferplatte mit Werkzeugen so zu bearbeiten, dass sie komplett aufgeraut wurde. Gedruckt hätte diese Platte eine komplett schwarze Fläche hinterlassen. Nun begann er damit, die aufgerauten Flächen der Platte mit allerlei Werkzeugen wieder zu glätten und zu polieren. Heraus kam dabei ein Portrait seiner Chefin, der Landgräfin Amelia Elisabeth von Hessen-Kassel, das erste gedruckte Halbtonbild, das ohne Linien auskam. Die Technik nennt man „Mezzotinto“ oder „Schabkunst“. Mir bleibt persönlich allerdings völlig unverständlich, warum der Kerl nicht weiter in den Süden gereist ist, in Hessen-Darmstadt hätte er schönere Frauen portraitieren können. Als Südhesse bestätigt es meine Einschätzung, dass Tage und Nächte in Nordhessen öde und langweilig sind. Sonst käme man einfach nicht auf die Idee, über Stunden und Tage eine Kupferplatte mit kleinsten Vertiefungen zu überziehen, nur um sie anschließend wieder zu verschließen. Es zeigt aber auch, dass man entweder total bescheuert sein muss, oder leidenschaftlich bei der Sache. Manchmal trifft auch beides gleichzeitig zu. Den Beweis trete ich auch gleich an, denn im Anschluss zeige ich, wie so ein Mezzotinto hergestellt wird. Das mache ich nicht zum ersten Mal, aber ich zeige es zum ersten Mal ausführlich.
Mezzotinto
Um es mit dem Arbeitsaufwand nicht zu übertreiben (so bin ich halt), habe ich mir eine relativ kleine Platte aus Kupfer ausgesucht. Meiner Meinung nach ist Kupfer die ideale Druckform für alle Techniken des manuellen künstlerischen Tiefdrucks und für ein „Mezzotinto“ unbedingt nötig. Mit Zinkplatten, die sonst gerne, weil billiger, als Alternative zu Kupfer verwendet werden, kommt man hier nicht wirklich weiter.
Die Kupferplatte hat in etwa die Größe einer Postkarte. Das Stück habe ich mir aus einer alten Druckpatte herausgeschnitten. Es ist die Rückseite einer Radierung, deren Auflage längst ausgedruckt ist; und entsprechend verratzt sieht die Oberfläche aus. In diesem Fall stört es mich nicht sonderlich. Sauber gemacht werden muss die Platte trotzdem.
Die Oberfläche von Kupfer reagiert auf ziemlich alles, und fast jede Reaktion hinterlässt Spuren, die man tunlichst entfernen sollte, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Im vorliegenden Fall benutze ich einen handelsüblichen Metallreiniger aus der Tube. Wenn die Platte einigermaßen blank und blitzend vor einem liegt, bemerkt man vielleicht auch, warum man von der „Schwarzen Kunst“ spricht. Jede Tätigkeit in diesem Bereich garantiert rabenschwarze Hände. Es gibt natürlich auch Weicheier oder Mädels die Handschuhe tragen. Die Auskenner wissen natürlich, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, aber man muss auch nicht alles verraten. Immerhin ist die Platte jetzt geputzt, die tiefen Kratzer ignoriere ich, ebenso den Plattenrand, der normalerweise noch geglättet und abgeschliffen werden müsste.
Auf dem Unterlagen-Papier hat sich der Schmutz der Kupferplatte verteilt. Mir kam es gerade recht, ich tränkte das Blatt mit verschiedenen Lösungsmitteln und hatte vor, es durch eine herbeigeführte Verpuffung in Blattgold zu verwandeln.
Diesen Versuch brach ich ab, weil mich drei Musen ablenkten, die unter der Atelierdecke herumschwirrten. Statt Blattgold nun drei gezeichnete Musen auf dem Schmutz einer Kupferplatte.
Darüber habe ich fast meine schön gereinigte Platte vergessen. Von dem Bildmotiv, das einmal die Platte zieren soll, habe ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Aber bei der nachfolgenden Arbeit werde ich einige (viele) Stunden Zeit haben, um darüber nachzudenken. Mit einem Wiegeeisen, das man auch Granierstahl oder Mezzotinto-Messer nennt, wird nun die komplette Kupferplatte, Punktlinie neben Punktlinie, aufgeraut. Die Funktionsweise dieses Werkzeuges ist ähnlich einem Wiegemesser, das man zum Kräuterschneiden in der Küche verwendet. Allerdings ist der Kraftaufwand ein bisschen höher als beim Kräuterschneiden. Die Zähne des Wiegeeisens müssen in die Metallplatte eingedrückt werden. In unserem Fall sind es 42 kleine Stahlzähne, die sich unzählige Male in ein postkartengroßes Stück Kupfer beißen müssen.
In der Regel fängt man an einer Ecke an und arbeitet sich, Linie um Linie, von links nach rechts durch. Wenn das Kupfer komplett mit waagrechten Linien bedeckt ist, beginnt man damit, sich von unten nach oben durchzuarbeiten, also vertikale Linien zu setzen. Wer dies, ohne geistigen Schaden zu nehmen, geschafft hat, kann jetzt eine Tasse Kaffee trinken und sich darüber freuen, dass die Hälfte der Arbeit erledigt ist. Im Anschluss darf sich das Wiegeeisen von linksoben nach rechtsunten durchbeißen und so diagonale Linien zu hinterlassen. Das ganze dann nochmal von rechts oben diagonal nach links unten. Die Platte ist nun in vier Richtungen aufgeraut, die Überlebenden haben es geschafft und freuen sich. Dieser Arbeitsschritt kann abgehakt werden. Die Platte ist mit einem dichten Punktraster überzogen. Würde man diese Platte nun abdrucken, wäre auf dem Papier eine schwarze Fläche zu sehen.
Ich hatte Zeit genug, um über ein Motiv nachzudenken. Das Ergebnis skizziere ich auf dünnes Transparentpapier, idealerweise sollte die Skizze die gleiche Größe wie die Kupferplatte haben. So lässt es sich leichter auf die Platte übertragen. Immer daran denken, dass das Motiv seitenverkehrt auf der Platte sein muss, um seitenrichtig gedruckt zu werden. Also, wenn ich AHA in die Platte ritze, kommt später ein AHA raus, ... ähh, Scherz. Das Motiv habe ich in diesem Fall nur mit groben Linien auf das Kupfer übertragen, der Rest soll sich bei der Arbeit ergeben.
Es mag die Arbeit erleichtern, wenn man sich in Gedanken klarmacht, dass man vor einer schwarzen Fläche sitzt, aus der nun die Weißanteile herausgearbeitet werden müssen. Als Werkzeuge dienen dazu verschiedene Schab- oder Poliereisen. Damit werden unsere mühsam erarbeiteten Vertiefungen in der Kupferplatte wieder entfernt, und zwar in Abstufungen so, dass an den hellsten Stellen im Motiv die Oberfläche der Platte glattpoliert ist und im Druck keine Farbe mehr aufnehmen kann.
An der ersten Druckversion erkennt man schon gut das Prinzip, auf dem das Ganze basiert. Außer den Kratzern, die schon vorher auf der Platte waren, gibt es keine einzige Linie im Bild, das gänzlich auf Halbtönen basiert. Bevor das Mezzotinto erfunden wurde, waren solche malerischen Effekte in der Druckgrafik völlig unbekannt.
Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2016
Die Sehnsucht nach dem Licht 1

Die Sehnsucht nach dem Licht 1
„Was-wäre-wenn-Fragen“ sind natürlich müßig, aber als Gedankenspiel durchaus unterhaltsam. Ich stellte mir die Frage, wie sich die Bilder von Caspar David Friedrich wohl verändert hätten, wenn er, wie sehr viele seiner Zeitgenossen, nach Italien gereist wäre. Er tat es nie, und seine Bilder blieben in ein deutsches Licht gegossen. In einem Brief an einen Malerkollegen schrieb C. D. Friedrich 1816: „Dank für Deine Einladung nach Rom zu kommen, aber ich gestehe frei, daß mein Sinn nie dahin getrachtet .... .“ Diese Ansicht war unter seinen malenden Kollegen fast ein Alleinstellungsmerkmal, aber vielleicht auch verständlich, wenn man diese Zeilen von ihm liest:
„Ihr nennt mich Menschenfeind
weil ich Gesellschaft meide.
Ihr irrt euch
Ich liebe sie
Doch um die Menschen nicht zu hassen,
muss ich den Umgang unterlassen.“
Die meisten Künstler wurden von dem Sehnsuchtsland hinter den Alpen magisch angezogen und scheuten auch keine Mühen, dorthin zu gelangen.
„Sehnsucht nach Italien ... Bei Tage und in der Nacht denkt meine Seele nur an die schönen, hellen Gegenden, die nun in allen Träumen erscheinen und mich rufen. Wird mein Wunsch, meine Sehnsucht immer vergebens sein?“.Das schrieb 1797 Ludwig Tieck in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, und er traf damit so etwas wie den Nerv der Zeit. Zumindest bei Malern und Schriftstellern des 19. Jahrhunderts, die sich in einer schier endlosen Kolonne Richtung Italien aufgemacht hatten. Und oft über Jahre geblieben waren, und manchmal dort auch starben. Ein Gipfeltreffen der deutschen Romantik. Alleine mit der Auflistung der Namen könnte man ein Buch füllen. Eine solche Menschenbewegung in Richtung Italien gab es erst wieder in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, als sich, nach überwundenen dunklen Zeiten, die Bildungsbürger in Deutschland aufmachten, ihr Arkadien zu entdecken. Mit ihren VW-Käfern und Borgward Lloyds fuhren sie dem Licht der Erkenntnis entgegen, wenn sie denn die Pässe schafften. Die romantisch beseelten Maler hatten es ungleich schwerer nach Süden zu gelangen. Außer dem quälenden Gedanken, unbedingt dorthin zu müssen, waren ganz praktische Dinge zu erledigen. Das Dringlichste war sicherlich, die Reisekasse zu füllen. Es wurden Darlehen und Vorschüsse erbettelt, Bittbriefe geschrieben und prinzipiell alles getan, um ein Landgrafenherz zu erweichen oder einen Staatsekretär wohlwollend einzunehmen. Der Maler Georg von Dillis schrieb 1817 in einem Brief an seinen Regenten, der ihm wohl eine weitere Reise nach Italien gesponsert hatte, auch etwas über die Beweggründe: „Bei dem frohen Gedanken, ich werde das gelobte Land, das Mutterland der Künste, nach so oft wiederholten Genuß mit neuen Reizen wiedersehen, erhebt sich meine Kunstseele mit belebter Kraft empor und sehnt sich hin nach der wahren Heimat des Künstlers, wo sein Geist zur wahren Reife gedeihen kann und ihn die Natur und er die Natur umarmt und so in Liebe erschafft, was die Nachwelt Jahrhunderte anstaunt.“ Andere Zeiten, andere Worte, aber Herzblut braucht man auch heute noch, wenn man den Geldbeutel von Sponsoren öffnen will. Und was die Nachwelt angeht, das jahrhundertelange Staunen blieb vielen Malern der deutschen Romantik versagt. Sie blieben einfach in ihrer Zeit zurück, und nur mit wenigen Namen weiß man heute noch etwas anzufangen.
Bei aller Großzügigkeit, die Weiterbildungsmaßnahmen ihrer talentierten Maler zu unterstützen, blieb das Budget für Reise und Aufenthalt immer knapp bemessen. Die Postkutschenfahrt mit Rückfahrticket, blieb den meisten verwehrt, wenn sie nicht gerade Goethe hießen oder von Haus aus begütert waren. Zu Fuß unterwegs findet man leichter die Zeit zum Zeichnen. Jeder der Reisenden füllte Skizzenbuch um Skizzenbuch. Zeichnungen, Aquarelle und Studienblätter galten damals eher als private Auseinandersetzung der Maler mit einem Stück Wirklichkeit und nicht als eigenständige Kunst. Es zählte das Ölbild und nur das wurde auch öffentlich ausgestellt.
Demnächst geht es hier weiter mit Aquarellen, Unfällen, vielleicht auch mit Todesfällen.
(Wer bis dahin selbst Klugscheißer werden will, suche in seiner Bibliothek nach Goethes Tagebuch der italienischen Reise, wenn möglich Kröners Taschenausgabe von 1925, die mit einem Goetheportrait von der Malerin Angelica Kauffmann aufwarten kann, über das Goethe selbst sagte: “Er ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir“. Mensch Goethe, guck halt in den Spiegel, wenn du dich sehen willst und nicht an die Wand. Nach Ludwig Richters Lebenserinnerungen von Seite 139 bis Seite 314 in der Insel TB-Ausgabe, den 2Bd. Handzeichnungen der deutschen Romantik aus dem Pawlak Verlag, dem Darmstädter Ausstellungskatalog über Johann Heinrich Schilbach, der Traum vom Süden, dem Ausstellungskatalog aus der Nationalgalerie in Berlin über Carl Blechen, dem Mannheimer Ausstellungskatalog über Turners Deutschland-Reisen, dem bei Prestel erschienen Bildband über Turners Reiseaquarelle, dazu noch einige Bände und Ausstellungskataloge über Irgendetwas, die nicht direkt mit dem Thema zu tun haben, aber trotzdem nicht unwichtig sind. Außerdem würde ich gerne noch das Buch mit Zeichnungen von Victor Hugo (Ja, der Schriftsteller hat auch gezeichnet) aufführen, das aber irgendwie verschwunden ist, ich finde es jedenfalls nicht mehr. Das ist schade, obwohl es nichts Erhellendes zur Wanderungsbewegung der Romantik nach Italien beitragen, dafür aber mit düsteren sepiafarbenen Zeichnungen aus dem Mittelrheintal aufwarten könnte. Wenn ich mich recht erinnere. (Keiner belügt mich so gut, wie mein eigener Kopf.) Die Zeichnungen hätten mich insofern interessiert, weil seit einigen Tagen auf meinem Schreibtisch eine Broschüre vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit dem „goldischen“ Aufdruck „Romantik in Hessen“ liegt. Der Aufdruck ist tatsächlich goldgeprägt, und ich finde es noch nicht einmal unpassend. Obwohl in Hessen meistens gilt: Des is awer goldisch, ... nix wie weg jetzt. Die Broschüre führt zu den Romantik-Orten in Hessen und zeigt ganz nebenbei, was Fotografie von Knipserei unterscheidet. Hier hat man einem guten Fotografen (Kilian Schönberger heißt er) das Bebildern der ganzen Broschüre gestattet, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine der zahlreichen Fotografien zeigt einen Innenraum im Brentano-Haus in Oestrich-Winkel. Neben dem vom Außenlicht weiß erstrahlendem Fenster hängt die Reproduktion einer Zeichnung von Tischbein, auf der sich Goethe aus dem Fenster seine römischen Wohnung lehnt.
„Hallo Angelica, wir sind hier oben im zweiten Stock, und über deine Zeichnung von mir, müssen wir aber nochmal reden, gell.“ Und schon wieder ist man in Italien, und den Goethe wird man sowieso nicht los.)
Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2016
Die Sehnsucht nach dem Licht 2
Die Sehnsucht nach dem Licht 2
Ob man Goethe ein klassisches Burnout attestieren würde, sei einmal dahingestellt. Seiner Reise nach Italien, wo er zwei Jahre verbrachte, ging jedenfalls eine größere Schaffenskrise voraus. Amtstätigkeit und kreatives Arbeit waren für den Hansdampf in allen Gassen nicht mehr so einfach unter einen Hut zu bringen. Mit Hilfe einer Kulturdröhnung im Licht Italiens und einer jungen Römerin, mit der er ins Bett hüpfte, kam er wieder in die Spur. Die aquarellierte Zeichnung von Tischbein, die ihn 1787 am Fenster seiner Wohnung in Rom zeigt, würde das bestätigen. Dieser Goethe ist ganz entspannt und lässig in Hauslatschen und legerer Kleidung, eigentlich ein ganz intimes, privates Bildchen. Ganz anders ist ein weiteres Bild von Tischbein, das ein Jahr früher entstand. Es zeigt Goethe als abgeklärten Reisenden (die Hausschlappen am entgegengesetzten Körperende durch einen Schlapphut ersetzt) in der Campagna. Dieses Bild kennt jeder und es wurde zu einem Inbegriff der deutschen Sehnsucht nach Arkadien. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein auf „Goethes Maler“ zu reduzieren, wäre in einiger Hinsicht nicht falsch. Die finanzielle Absicherung seines zweiten Aufenthalts in Italien (ab 1783) verdankte er der Vermittlung von Goethe, der ihn damals noch nicht persönlich kannte. Beide lernten sich erst 1786 in Rom kennen und freundeten sich an. Tischbein darf auch als exemplarisches Beispiel für einen Epochenwechsel herhalten, der bei vielen Malern dieser Generation in Italien stattfand. Vereinfacht kann man sagen, Tischbein reiste als Rokokomaler nach Rom und kam einige Jahre später als klassizistischer Maler wieder nach Deutschland zurück. Kunstgeschichtlich wird die Epoche von 1770 bis 1840 als Klassizismus eingeordnet. Begleitet wird diese Zeit in der Malerei von der Romantik und dem Biedermeier. Eigentlich wollte ich mir das Einordnen in Schubladen ersparen, und bevor das alles jetzt in eine brave kulturgeschichtliche Hausarbeit ausartet, mache ich hier einen Break und bringe das richtige Leben ins Spiel, und da geht es doch, wie wir alle wissen, recht blutig zu, weil es sich noch nicht allgemeingültig herumgesprochen hat, dass Gewalt keine Lösung ist.
In dem Wort „Strick“ klingt immer ein ungutes Ende mit.
Diesmal nicht, denn so sehr sich auch Francesco mühte, den Strick an beiden Enden zuzuziehen, der Typ schnappte immer noch nach Luft, und er war erstaunlich kräftig. Töten ist nicht so einfach, wenn sich das Gegenüber, weshalb auch immer, wehrt. Schließlich waren es sieben Stiche mit dem Messer, die dieses Tötungsdelikt sehr blutig werden ließen. Einfach war es nicht, denn auch hier griff das Opfer in seiner Todesangst mit beiden Händen in die Klinge, um weitere Stiche abzuwehren. Aber irgendwann geht auch der Stärkste in die Knie und Francesco konnte sich die Gold- und Silbermünzen schnappen, die der Grund für diese mörderische Attacke waren und mit ihnen das Weite suchen. Auf dem Boden des Hotel-Zimmers blieb sein blutüberströmtes Opfer zurück, ... und lebte noch ganze sechs Stunden weiter, obwohl sechs der sieben Messerstiche für sich genommen schon tödlich waren. Der Raubmord geschah am 8. Juni 1768 in einem Hotelzimmer in Triest. Im kalten, dunklen Novembergrau sitzend, nehme ich mal an, dass es ein schöner Tag war, so wie man sich einen warmen Junitag in Triest eben vorstellt, aber es spielte keine Rolle, wenn man gerade zum letzten Mal ins Licht der Welt blickte. Damals gehörte Triest noch zu Österreich und Francesco hätte sich eigentlich gar nicht dort aufhalten dürfen. Der in der Toskana geborene 31 jährige Italiener Francesco Arcangli war in Wien, wo er als Dienstmann arbeitete, straffällig geworden und des Landes verwiesen. Das mit der Ausweisung hat nicht so richtig geklappt. Francesco lernte sein Opfer schon Tage vor der Tat kennen. Zufällig logierte er als Zimmernachbar im selben Hotel. Im Gegensatz zu Francesco durfte sich sein Opfer ganz legal in Triest bewegen, wollte das aber gar nicht, weil er dringend weg wollte und eine Gelegenheit zur Überfahrt nach Venedig suchte. Ob die homoerotischen Neigungen des Opfers dabei eine Rolle spielten, weiß ich nicht, aber die angebotene Hilfe von Francesco bei der Suche nach einem Schiff, nahm er jedenfalls gerne an. Im Nachhinein betrachtet, war es sicherlich unklug vom Opfer, diesem Francesco auch noch seine Silber- und Goldmünzen zu zeigen, die er persönlich am österreichischen Hof von der Kaiserin geschenkt bekommen hatte. Wie schon beschrieben, wurde diese Angeberei auch schwer bestraft. Allerdings durfte sich Francesco auch nicht sehr lange an seinem kleinen Schatz erfreuen, denn er wurde relativ schnell erwischt. Das lag unter anderem auch daran, dass sein Opfer einige Stunden im Sterben lag und während dieser Zeit sehr genau und überraschend klar den Täter und den Tathergang schildern konnte. Na ja, gestorben ist er trotzdem und tot ist nun mal tot. Das galt übrigens auch für Francesco, der die Toskana nicht wieder sah, sondern in Triest öffentlich gerädert wurde. Für meine Generation war die Toskana der Inbegriff Italiens. Kaum Besseres war vorstellbar, als dem ewig engen dunklen und neblig trüben Deutschland zu entfliehen, der Sonne, dem Licht, der Pasta, dem Wein und dem Olivenöl entgegen, und das am liebsten mit Zweitwohnsitz vor Ort. Wer heute in die Toskana will, muss nicht mehr nach Italien reisen, so jedenfalls lauten die touristischen Verheißungen, die uns die deutsche Toskana vom Breisgau bis in die Uckermark versprechen. Kaum eine Region, die nicht mit ihrer Toskana wirbt. Für die Maler des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts, die sich auf den Weg nach Italien machten, war die Toskana, wenn sie denn überhaupt auf ihrem Radarschirm erschien, eher ein nachgeordnetes Reiseziel. Wer nach Italien wollte, meinte damit Rom. Die Stadt stand im Mittelpunkt des Interesses, als jahrhundertelange Ikone weltlicher und christlicher Geschichte. An Rom, der ewigen Stadt kam keiner vorbei.
Meinen Toten aus Triest habe ich nicht vergessen. Das Opfer war kein Unbekannter. Er hieß Johann Joachim Winckelmann und gilt als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigem Raum. Nebenbei durfte er sich rühmen, die moderne wissenschaftliche Archäologie und die Kunstgeschichte ins Leben gerufen zu haben. Seit 1755 lebte er in Rom und beeinflusste mit seinen Theorien und Schriften eine Unmenge von Malern, darunter Angelica Kauffmann und Anton Raphael Mengs, einer der besten klassizistischen Maler in Deutschland. Beide portraitierten auch den lebenden Winckelmann. Das interessanteste Portrait Winckelmanns stammt aber von Anton von Maron, der ihn mit Turban in einem roten pelzbesetzten Teppich mit Ärmeln - ich nenne es mal Morgenmantel - gekleidet zeigt. In Italien war man schon immer sehr modebewusst.
Demnächst mehr Licht.
Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2016
Die Sehnsucht nach dem Licht 3

Die Sehnsucht nach dem Licht 3
Alle Wege führten nach Rom. Obwohl die damaligen Reisebedingungen alles andere als einfach waren. Aber auch Gedanken können ja manchmal beflügeln und beschwerliche Wege erträglich gestalten. Zwischen 1800 und 1830 lebten in Rom rund 550 deutsche Maler, Bildhauer und Architekten. Dazu kamen noch die Dichter und die Franzosen, Engländer usw., ich nehme an, dass auch ein paar Italiener dort waren. Aber in der Regel wurden sie wohl eher als folkloristische Staffage vor klassischen Veduten wahrgenommen. Was nicht ausschloss, dass die jungen Maler ihre Skizzenbücher auch mit Genre-Szenen füllten. Grundsätzlich suchte man aber die Antike, die Schönheit, die ideale Landschaft und nicht den Italiener im damaligen hier und heute, sieht man mal von Johann Gottfried Seume, der nach Syrakus spazierte, ab. Der war auch nicht als Maler unterwegs. Von Heine stammt die ironische Bemerkung: „ .... sehen Sie mal die Bäume, den Himmel, da unten das Wasser – ist nicht alles wie gemalt? Haben Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird, sozusagen, ein Dichter!“
Für junge Maler fand in Italien ein Selbstfindungsprozess im Reich der (romantischen) Einbildungskraft statt. Und man sprach deutsch dabei. Und alle trafen sich in Rom beim Griechen. Das 1760 von einem Griechen gegründete „Caffé Greco“ ist wohl heute noch eines der bekanntesten Künstlercafés, nicht nur in Rom. Hier bin ich Maler, hier darf ich sein ... eine Zeichnung von Carl Philipp Fohr gibt einen schönen Einblick in das wuselige Künstlertreiben in dieser, damals einfachen, Gastwirtschaft. Der Zeichner selbst konnte es gar nicht lange genießen. Er ertrank, 22jährig, unter tragischen Umständen vor den Augen seiner Freunde im Tiber. Ja, der Übermut junger Kerle. Ein anderer Deutscher, E.T.A. Hoffmann, würdigt das Caffé Greco in seinem Capriccio nach 8 Radierungen von Jaques Callot, „Prinzessin Brambilla“. Wer dieses Stück Literatur lesen möchte, sollte viel Zuversicht mitbringen, denn es ist ebenso burlesk wie die Radierungen von Callot, die Hoffmann dazu inspiriert hatten.
Eigentlich war meine Situation zum Verzweifeln. Ich saß zwar nicht beim Griechen in Rom, aber immerhin innerstädtisch fest. Spät abends fehlte mir einfach die Kraft, an die etwa hundert Meter entfernte nächste Döner-Klappe zu robben. Es gibt solche Tage, an denen die Kraft einfach nicht mehr ausreicht, schon gar nicht, um mit dem eigenen Kochgeschirr zu klappern. Da ich nicht elendig verhungern wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als eine der zahlreichen Notrufnummern zu wählen, die sich im Laufe eines Jahres in einer versteckten Ecke der Wohnung gesammelt hatten. Asiaten liefern, klar, Inder auch, Mexikaner, Italiener und Spanier sowieso. Nur die Griechen tun sich mit dem liefern schwer, da muss man schon nach Rom. Nachdem die Notrufnummer gewählt ist, muss man nur noch einen Zahlencode mit letzter Kraft in den Hörer stammeln und schon ist etwas auf den Weg gebracht, vor dem jeder Ernährungsberater dringend abraten würde. Solche Codes haben den unschätzbaren Vorteil, auf sprachliche Kommunikation außerhalb von Zahlenkolonnen völlig verzichten zu können, das ist sehr hilfreich, wenn auf beiden Seiten des Hörers nur rudimentäre Kenntnisse der Sprache des jeweils anderen bestehen. Um beim Thema zu bleiben, fiel meine Wahl auf die Code-Nummer 310, die steht für ein postkutschenradgroßes Schnitzel, das auf jedwede Inhaltsstoffe verzichtet und deshalb auch unbedenklich verzehrt werden kann. Dem dringenden Notruf angemessen, wurde recht zügig geliefert, und zwar von einem Pakistani. Im dunklen Hausflur die Treppen hochtapsend auf der Suche nach der Wohnung rief er mehrmals laut und gut hörbar „eh Jude“. Als wir uns für das Geschäftliche endlich auf der gleichen Stufe begegneten, war mein Blick auf ihn vermutlich recht irritiert, und irgendwie war ich es auch. Ich sag mal so: normalerweise bin ich freundlicher zu den armen Kerlen, als ich es vielleicht an diesem Abend in meiner Verwirrtheit war. Nachdem sich im Laufe der Nacht das Volumen meines Schnitzels auf Handtellergröße verringert hatte, kam mir die Erleuchtung. Mein pakistanischer Schnitzel-zu-mir-Roller hat versuchte in „hessisch“ zu kommunizieren, und er rief nicht “eh Jude“, sondern die urhessische Begrüßungsformel „ei Gude“. Das ist so wie in Norddeutschland „Moin“ oder „Servus“ in Bayern. Es kann schon zu Missverständnissen führen, wenn ein mäßig hessisch sprechender Pakistani auf einen in Codes denkenden ausgehungerten Hessen trifft. Sei’s drum, nix passiert. Wenn er das nächste Schnitzel zu mir rollt, werde ich ihm ein „ei Gude, wie“ entgegenrufen und gud is. Vermutlich antwortet er dann 1 mal 310 mit 4 aber ohne 17.
„Messieurs les Voyageurs on their return from Italy ( par la diligence ) in a snow drift upon Mount Tarrar, 22nd of January, 1829“. Das ist der Originaltitel einer Aquarell- und Deckfarbenarbeit von William Turner. Vom Dauerreisenden Turner weiß man, dass er sich in einigen europäischen Sprachen verständigen konnte, nur bei seinen Reisen durch Deutschland führte er immer zwei Sprachführer mit sich. Womöglich sogar „Hessisch für Anfänger“. Der Engländer Turner war unter den reisenden Malern des 19. Jahrhunderts wohl der umtriebigste und kam auf 18 Festlandsreisen. Dass er dabei die bis dato liniengeprägte Aquarellkunst revolutionierte, ist hinlänglich bekannt. Er war seiner Zeit weit enteilt und konnte mit Licht weitaus mehr anfangen als alle anderen seiner Zeitgenossen. Dass aber auch der Turner-Express manchmal ins Stocken kam, davon erzählt jenes Bild der Reisenden, deren Postkutsche in einer Schneewehe auf der Rückreise von (in) Italien liegenblieb. Turner war einer der Reisenden und erzählte von diesem Ereignis auch ausführlich in einem Brief vom Februar 1829: „Nun zu meiner Heimreise. Glaub mir, kein armer Teufel hatte je eine wie ich, doch war sie wenigstens in einem lehrreich, nämlich, nie wieder so tief im Winter aufzubrechen, denn der Schnee begann bei Foligno zu fallen, mehr Eis als Schnee, so dass die Kutsche durch ihr Gewicht hin und her schleuderte. Zu Fuß zu gehen war bei weitem vorzuziehen, doch meine unzähligen Leibröcke verweigerten mir den Dienst, so war ich bald durch und durch nass, bis bei Sarre-Valli die Postkutsche in einen Graben rutschte; es bedurfte sechs Ochsen, nach denen man 3 Meilen weit hatte schicken müssen, um sie herauszuziehen; das kostete 4 Stunden, so dass wir in Macerata mit zehn Stunden Verspätung ankamen, folglich gelangten wir halb verhungert und erfroren schließlich nach Bologna“.
Das Feuer, an dem sich die Reisenden versammeln, hält sich bedeckt. Es leuchtet nicht wärmend gelborange, sondern in gedeckten Ockertönen, und ob es die ihm entgegengestreckten Hände wirklich wärmt, erscheint zweifelhaft. Die große, im Licht des Feuers fast schemenhafte Kutsche ist in Schieflage geraten und steckt fest in Eis und Schnee. Ich weiß nicht so recht, was mir lieber wäre, in eine nasse Decke gehüllt an diesem lodernden Feuer zu sitzen, das nicht wirklich wärmt, oder mir eine der Schaufeln zu greifen, die im Vordergrund im Schnee liegen. Andere tun das schon. Sie schaufeln, knietief im Schnee stehend, die großen Speichenräder der Postkutsche frei, und sie ziehen an Seilen um sie aufzurichten, oder treiben das Ochsengespann an, das selbst fast vom Schnee verschluckt wird. Ob es gelingt ist nicht ersichtlich. Einer in Uniform, vermutlich der Postkutscher, überwacht die Tätigkeiten, gibt Anweisungen in dieser gespenstigen Nacht, die vom Feuer nur schwach ausgeleuchtet wird. Über allem ein dunkler wolkenverhangener Himmel und der Rauch von nassem Holz. Nur eine Handvoll Sterne und ein milchiger Mond geben die Wolken zaghaft frei. In dieser preußischblauen Nacht, die sich bis ins tiefste Schwarz verfinsterte, weiß niemand so genau, wo die Berge enden und der Himmel anfängt. Nur der Abgrund ist ein paar Meter vom Feuer entfernt wahrzunehmen, wo er endet sieht man nicht. Bei diesem Postkutschen-Unfall lässt Turner in einem einzigen Bild einen ganzen Reportage-Film vor dem Betrachter ablaufen. Der Winter mag damals nicht die ideale Reisezeit gewesen sein, aber schlimmer geht immer. Es gibt zahlreiche zeitgenössische Berichte, die von Raub und Wegelagerei berichten, und auch davon, dass ganze Reisegesellschaften gemördert wurden, um ein paar Habseligkeiten reicher zu werden. Die wichtigsten Dinge, Papiere und Geld, trug man möglichst am Leib.
Das erinnert mich doch sehr an mich. Meine Hosen und Jacken sind immer ausgebeult, weil ich dazu neige, möglichst viel von meinem Hausrat mit mir rumzuschleppen. So manch einer ist schon überrascht in die Knie gegangen, weil er mir freundlicher Weise meine Jacke abnehmen wollte. „Mann, ist die schwer, was is’n da alles drin?“ Alles! Vom Akku bis zum Zelt. Man weiß doch nie, wo man liegenbleibt.
Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2016
Die Sehnsucht nach dem Licht 4

Die Sehnsucht nach dem Licht 4
„Azzurro, zu blau ist der Nachmittag und zu lang für mich. Ich spüre, dass ich kaum noch Kraft habe, seit du weg bist, und da, hätte ich beinahe den Zug genommen, und wäre zu dir, zu dir gekommen, aber der Zug meiner Wünsche und meiner Gedanken fährt in die andere Richtung.“Ok, der Zug ist wohl abgefahren, lieber Adriano, aber immerhin hast du den blauen Himmel, ... und der ließ sich mit deiner Reibeisenstimme so gut verkaufen, dass er 1968 die meistverkaufte Single in Italien wurde. Und in der deutschen Schlagerwelt zum Sehnsuchtslied wurde. Himmel, dabei ist „Azzurro“genaugenommen nur eine blaue Fläche. So kann man es jedenfalls als Maler sehen, und damit muss man erst mal zurechtkommen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die malenden romantischen Italienreisenden im 19. Jahrhundert mit dieser Farbfläche ein bisschen schwer taten. Fast immer finden sich Unterbrechungen. Damit meine ich nicht das eigentliche Sujet aus Bäumen, Bergen und was auch immer, die natürlich auch in den Himmel ragen, sondern den Himmel an sich. Wenn es zu Blau wurde, kamen die Wolken, Wölkchen oder Dunststreifen und sorgten aus malerischer Sicht dafür, dass das „Azzurro“nicht zu aufdringlich eintönig wurde. „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt ...“hat sich die Sache mit dem „Azzurro“von selbst erledigt.
Und schon sind wir im Mezzogiorno, dem zweiten großen Sehnsuchtsziel für die deutschen Maler des 19. Jahrhunderts in Italien. Die geistige Sehnsucht wurde in Rom, der ewigen Stadt, so gut es ging befriedigt, aber als wahres irdisches Paradies lockte Neapel. Vermutlich gehören der Golf von Neapel und die Amalfi-Küste zu den am meist gemalten Motiven in der damaligen Zeit. In kleinen oder auch größeren Gruppen wanderten befreundete Künstler die rund 250 Kilometer von Rom nach Neapel, und sie zeichneten und zeichneten. Noch Jahre später, längst zurück im dunklen und kalten Deutschland, diente ihnen dieser erzeichnete Schatz als unerschöpflicher Fundus, der in ihren Bildern seine Verwendung fand. Ein Schatz gewissermaßen auch heute noch. Bei einem Auktionshaus wird aktuell ein kleines 34 x 43 cm Ölbildchen von Ludwig Richter, der von 1823 bis 1826 in Italien verweilte, für schlappe 250.000 Euro Taxe angeboten. Die „Ansicht von Bajae in der Bucht von Neapel“ malte Richter 1830, längst schon wieder in seinem Meißner Atelier sitzend, und solche italienische Sehnsuchtsbilder ließen sich gut verkaufen, so gut, dass er das Motiv noch ein weiteres Mal pinselte. Eine wunderbare Landschaft und ein wenig Folklore - in diesem Fall ein paar Fischer am Strand - genügten, um die Lust beim Betrachter auf Italien zu befeuern. Für die jungen Künstler selbst wurde eine Salve der Inspiration nach der anderen abgefeuert. Richter schrieb: „In Neapel schloß sich eine neue Zauberwelt auf, recht eigentlich ein Paradies für Landschaftsmaler.“.
Ein junger Darmstädter Maler, Johann Heinrich Schilbach, lebte 5 Jahre in Rom und gehörte zu der Gruppe von Malern, mit denen Richter von Rom nach Neapel wanderte. Aus einer durchaus nicht unüblichen finanziell klammen Situation heraus, schrieb er in einem Brief an einen Freund: „ .... wenn es nicht besser geht, so packe ich mein Bündel bald ... In Deutschland kann ich viel leichter was verdienen, weil nicht so viele Künstler da sind.“. Ja, die Deutschrömer hatten es nicht leicht. Kaum ein Jahr nachdem Schilbach diesen Brief geschrieben hatte, packte er tatsächlich sein Bündel, allerdings hatte sich zu diesem Zeitpunkt seine Situation durch Bildverkäufe ein wenig verbessert, und er marschierte Richtung Neapel, dem Licht entgegen. Er bestieg zusammen mit Richter den Vesuv, setzte nach Amalfi und Capri über, und drei Jahre später brachte er einen gewaltigen Packen Papier mit zurück nach Darmstadt. In Italien fand im 19. Jahrhundert eine riesige Plein-air-Veranstaltung statt, an der so ziemlich jeder junge deutsche Maler teilnehmen wollte. Eigentlich ist das Malen ja eine einsame Tätigkeit, aber hier ballte sich alles in Gruppen zusammen, man wanderte und zeichnete, aquarellierte, .... und vermutlich trieb man sich so gegenseitig zu immer neuen Höhepunkten an. Mein böser Kopf hakt hier ein und sagt, dass man auch zu wenig Platz hatte, um sich aus dem Weg zu gehen. Caspar David Friedrich wusste das womöglich auch.
Nachtrag: Es ist klar, dass eine kleine Blog-Serie nur ein wenig an der Oberfläche eines Themas kratzen kann. Als ich damit anfing, hatte ich ganz anderes im Sinn, aber so ist das manchmal. Das Italien der Maler im 19. Jahrhundert ist ein gigantisches Spinnennetz, von dem unzählige Querverweise auf die gesamteuropäische Kunst ausgehen. Ich würde sogar behaupten, dass ohne die fleißige Vorarbeit der romantischen Maler (und Literaten) Italien nicht zu dem touristischen Sehnsuchtsland der Deutschen geworden wäre. Vermutlich wären uns dann auch in den 60er und 70er Jahren unzählige gespachtelte Sonnenuntergänge mit Fischerbooten oder glutäugige Südländerinnen erspart geblieben, die zahlreiche Wohnzimmerwände schmückten. Ich belasse es jetzt damit, noch einige Stichpunkte aufzuführen, deren nähere Betrachtung sich gelohnt, aber ganz sicher den Rahmen noch mehr gesprengt hätten: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Monica Bellucci, Ornella Muti, Isabella Rossellini.
Text und alle Abbildungen: Dieter Motzel 2016
20512 VIP
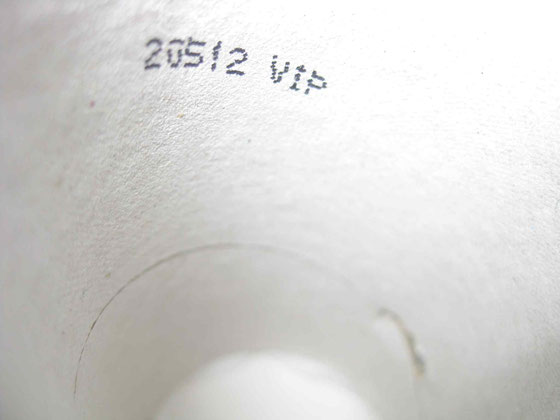
20512 VIP
Diese beachtliche Zahl wurde mir von einer Klorolle mitgeteilt. Ich nehme an, dass die Zahl nur die A-Promis beinhaltet. Mit B-, C-, D-Promis müsste sie erheblich höher liegen, wenn man davon ausgeht, dass sich die Zahl auf deutsche VIPs bezieht. Länger schon hegte ich den Verdacht, dass ein Klorollenproduzent mit solchen Indiskretionen eine interessierte Öffentlichkeit sucht. Natürlich ist es ein sehr perfider Plan, die Bevölkerung mit diesen Zahlen an einem Ort zu überraschen, der kein entrinnen zulässt, meist jedenfalls. Manche Menschen verbringen dort Ewigkeiten, und solche Mitteilungen verlängern diese Ewigkeit um eine weitere halbe, während andere vor der Tür, schon ein wenig verkniffen, darauf warten, endlich an die Reihe zu kommen.
Während von draußen die Tür beklopft wird, beschäftigt mich eine Zahlen- und Buchstabenkombination: 591569-RIP. Ja, klar, denke ich mir. „Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube“, so steht es im Matthäus Evangelium.
„Der Blindensturz“ ist ein wunderbares Bild von Pieter Bruegel d. Ä., der heute vor 443 Jahren gestorben ist. Auf dem Format 84 x 154 cm sind sechs Blinde im Fallen begriffen. Bruegel musste sich nicht sehr viele Temperafarben in seiner Werkstatt mischen lassen, er nutzte eine sehr reduzierte Farbpalette aus Ocker-, Braun- und Blaugrautönen, die mir sehr behagt. Die sechs Blinden auf dem Bild sind in einen Bewegungsablauf eingebunden, von Gehen, Stolpern, Fallen und Liegen, der sich über die gesamte Bildbreite entwickelt. Der erste ist schon gefallen und liegt in einem Wasserloch, der zweite würde eine Sekunde später stürzen, wenn ihn nicht der Pinsel von Bruegel dazu verdonnert hätte, auf ewig zu fallen, ohne jemals den Boden berühren zu dürfen. Auch die anderen des zerlumpten Bettlertrupps würden unweigerlich folgen. Sie sind verbunden wie eine Seilschaft am Berg. Stürzt einer, so stürzen alle. Sie halten sich an Stöcken, die auch der jeweilige Vordermann greift, oder sie haben eine Hand auf die Schultern des Vorgängers gelegt. Der, der ewig fallen muss, schaut den Betrachter an. Keine einfache Leistung, wenn keine Augen mehr vorhanden sind, denn sie wurden ihm ausgestochen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, die Blinde meist mit geschlossenen Augen darstellten, malte Bruegel sie mit offenen „Augen“ sehr detailgenau. Die Wissenschaft kann genau bestimmen, an welchen Augenkrankheiten drei der sechs Protagonisten litten, die zu ihrer Blindheit geführt haben. Wobei „ausgestochene Augen“ auf andere Krankheiten Rückschlüsse zulässt. Zu Zeiten Bruegels schlichen viele Blinde durch die Gegend. Sie waren ein alltäglicher Anblick. Die unterste Stufe der damaligen Gesellschaft, die zumeist verwahrlost auf der Straße lebte, immer auf Almosen angewiesen, die nicht sehr reichlich flossen. Blindheit galt als Strafe Gottes, und die örtlichen Vertreter des lieben Gottes sind ja bis heute nicht zimperlich im Benennen von Dingen, die dem lieben Gott gefallen oder eben auch nicht.
Wobei wir wieder auf dem stillen Örtchen wären. Der Klorollenproduzent hat heute keine weiteren Nachrichten für mich.
Text und Abbildung: Dieter Motzel. 2012
Alter Schwede
Alter Schwede I
Schon viele Tage war die Welt eingefroren. Der blaue Himmel, der Fluss, die Bäume und der Atem. Das Eis knirschte an einigen Stellen, die vor dem hartnäckigen Biss der Kälte geschützter waren. Die Füße tasteten sich vorsichtig voran. In der zurückliegenden Nacht waren Wolken aufgezogen. Mit dicken schneegrauen Bäuchen entzogen sie den leuchteten Sternen des Himmels den Blick auf das irdische Treiben. Der mäßige Frost in dieser Nacht hatte immer noch ausgereicht, um die Löcher, die Fischer in das Eis des Rheins geschlagen hatten, wieder zufrieren zu lassen. Das Licht des Morgens blieb fahl, auch wenn für einen kurzen Moment die Wolken eine Lücke ließen und die Sonne einige gefächerte Strahlen auf den Himmel zeichnen konnte. Weit über dem anderen Ufer des Flusses fielen die Sonnenstrahlen zu Boden, ließen ein Dorf erahnen, eine Kirchturmspitze. Der Junge war zu sehr damit beschäftigt, seinen Tritt sicher auf die Eisfläche zu setzen, als dass er diesen Moment des Lichtes wahrgenommen hätte. Der alte Mann, den der Junge führte, konnte es auch nicht sehen. Er war blind. Aber vielleicht spürte er diesen Augenblick. Er, der Einsiedler war sensibel für solche Stimmungen. Das samtene Schwarz, in das seine Augen blickten, war reich bevölkert mit Dingen, die anderen Verborgen blieben.
Einige Krähen wurden aus den Ästen der Bäume, die sich zwischen den kahlen Köpfen der Korbweiden aufrichteten, aufgeschreckt. Sie zeterten wild, und auch der Junge schaute zum Ufer, konnte aber den Grund ihrer Empörung nicht entdecken. Der alte Mann zog an dem dünnen Stock, an dem sich beide festhielten. Der Alte spürte das Zögern des Jungen, dessen vorsichtigen Schritt, und er drängte zur Eile. Er roch bereits den nahenden Schnee. Und was schlimmer war, er hatte ein ungutes Gefühl.
Sie waren fast in der Mitte des zugefrorenen Flusses angelangt, als sich zwei Männer näherten. Sie hatten sich aus dem Dunkel der Uferbäume gelöst. Die Sonne brach unvermittelt aus einem winzigen Spalt zwischen den Wolken hervor. Das gegenüberliegende Ufer erstrahlte in einem goldenen Licht. Der Junge sah es nicht. Er sah aber die funkelnden Augen der beiden Männer, die nur noch wenige Schritte entfernt waren. Der alte, blinde Mann stand regungslos, als der erste Schlag ihn zum fallen brachte. Ein weiterer Schlag traf seinen Kopf und es klang, als wollte die Eisdecke des Flusses bersten.
110 Jahre später steht ein Schwede an dem Ufer des Rheins. Es ist Dezember, ein paar Tage vor Weihnachten. Feuchtigkeit und Kälte dringen langsam in seine Stiefel ein. Er wünschte sich, dass dieser verdammte Fluss zugefroren wäre. Der Rhein ist noch keine begradigte Rinne, sondern ein mäandernder Wasserlauf, mit Nebenarmen, Schlingen und Schleifen. Verzierungen, wie sie nur ein großer Strom zustande bringt. Das angrenzende Land ist morastig und sumpfig, ohne feste Zufahrtswege. An manchen Stellen ist der Rhein hier 300 - 400 Meter breit, ein mächtiger Fluss. Der Blick des Schweden ist auf die andere Seite des Flusses gerichtet. Die Kälte seiner durchnässten Stiefel spürt er nicht. Am gegenüberliegenden Ufer sieht er auf eine Halbinsel mit Feldern, Wiesen und vereinzelten Baumbeständen. Dass die feuchten Wiesen einmal „Schwedenfriedhof“ heißen werden, weiß er nicht. Sein Blick wandert weiter nach rechts, bis er die fernen Lichter von Oppenheim sieht, das sich beschaulich zu Füßen einiger Weinberge am Ufer des Rheins niedergelassen hatte. Dort will er hin, und dazu muss er über den Fluss.
Alter Schwede II
Die Stelle, an der unser Schwede grübelnd in den Rhein blickte, ist heute mit 24 Quadratkilometern das größte Naturschutzgebiet in Hessen und Europa-Reservat. Die Halbinsel auf die er blickte, ist seit 1829 eine Insel, und aus dem Hauptstrom wurde an dieser Stelle ein Altrheinarm. Geblieben ist eine einzigartige Urwald-Auenlandschaft, die weitgehend sich selbst überlassen ist. Im Sommer beherrschen biestige Stechmücken das Land und manchmal attackieren auch liebestolle Keiler harmlose Spaziergänger, wie wir an anderer Stelle schon berichteten. Im Dezember des Jahres 1631 dürften zumindest die gefürchteten Rheinschnaken den Schweden verschont haben.
Man darf davon ausgehen, dass der Schwede lange grübelnd in das trübe Wasser des Rheins geschaut hat. Er hat dabei ganz sicher nicht über Weihnachtsgeschenke nachgedacht. Das logistische Problem, mit dem er sich beschäftigte, war weitaus größer als rechtzeitig Geschenke für die ohnehin nicht darbende Verwandtschaft zu besorgen. Der Schwede war nicht allein, er hatte noch weit über 10.000 andere Schweden mitgebracht, was naturgemäß das Übersetzen ans andere Ufer erschwerte. Ein weiteres Problem waren die Spanier, die nicht unbedingt mit den Schweden Weihnachten feiern wollten, aber auf der anderen Seite des Flusses saßen. So europäisch wie zu dieser Zeit, war Europa selten. Der Schwede war Gustav Adolf, der ein Jahr vorher mit seiner gut organisierten Armee über die Ostsee setzte. Wenn sich Europa schon kloppte, wollte auch er dabei sein. Wir befinden uns mitten im Dreißigjährigen Krieg, und der Schwede gab mit seinem Kriegseintritt der protestantischen Sache einigen Auftrieb.
Für die Bevölkerung jener Tage, war es sicherlich keine größere Überraschung, wenn plötzlich ein paar Tausend Schweden an die Tür klopften, um eine Kleinigkeit zum Essen zu fordern. Ob nun Freund oder Feind an die Tür klopften, im Ergebnis war es ähnlich. Nur der Freund zündete, nach dem er die brauchbaren Vorräte akquiriert hatte, nicht noch die ganze Scheune an. So mancher Bauer wird schon im Dezember an seinen letzten Kohlstrünken genagt haben … und die langen Wintermonate standen eigentlich noch bevor. Dass die Schweden auch noch sämtliche Scheunentore mitnahmen, dürfte die triste Winterstimmung nicht wesentlich erhellt haben.
Am 7. Dezember 1631 setzte die schwedische Armee unter Führung von Gustav Adolf, mit Hilfe dieser Scheunentore, über den Rhein. Zur damaligen Zeit war es eine logistische Meisterleistung. Das wusste auch Gustav Adolf, der an dieser Stelle sein eigenes Denkmal errichten ließ. Die „Schwedensäule“ steht noch immer und weist auf dieses historische Ereignis hin.
Auf dem Boden des heutigen Naturschutzgebietes wurde die spanische Reiterei in einer blutigen Schlacht besiegt. Das Gebiet heißt seit dieser Zeit „Schwedenkirchhof“ oder auch „Schwedenfriedhof“. Zwei Wörter mit gleicher Bedeutung, die für sich sprechen. Die schwedische Armee besetzte im Anschluss Oppenheim und marschierte weiter in die Bischofsstadt Mainz, die sich kampflos ergab. Dort wurde Weihnachten verbracht und dort suchte Gustav Adolf auch Weihnachtsgeschenke aus. Leider.
Alter Schwede III
Die Luft stieg in großen Blasen wie durchsichtige Quallen zu der Oberfläche des Wassers auf. Kleine Bläschen tanzten dazwischen, stießen sich an den großen, taumelten weiter in dem trüben aufgewühlten Wasser. Immer weiter und unablässig in Richtung Oberfläche, um sich dort wieder mit ihrem Element zu vereinen. Ganze Schwärme fanden sich zusammen bei ihrem Aufstieg. Auf ihrem Weg nach oben kamen ihnen Körper entgegen. Einige wehrten sich noch, bis sie die letzten Luftblasen aus ihrer Kleidung geschüttelt hatten und sanken dann unaufhaltsam nach unten. Der blinde alte Mann lag bereits seit über hundert Jahren regungslos, erschlagen. Unter ihm lag der Junge, der in geführt hatte. Der Junge schreit immer noch um sein Leben. Er wird weiter schreien, bis sich die Farbe von den Holztafeln, auf dem Grund der Ostsee, langsam abzulösen beginnen.
Am 23. Dezember 1631 marschierten die Truppen, mit dem Schweden an der Spitze, in Mainz ein. Vier Tage vorher hatte der Erzbischof mit dem schönen Namen Anselm Casimir Wambolt zu Umstadt das Weite gesucht, um in Köln einen Asylantrag zu stellen. Seinen Dom ließ er aus unbekannten Gründen zurück, ansonsten wird er sicherlich nicht mit leeren Taschen in Köln angekommen sein. Ob sich die Mainzer bei der Installierung des neuen Staates und der Säkularisierung ihres Erzstiftes wohlfühlten, darf bezweifelt werden. Nachdem die Religionsfreiheit von den Schweden eingeführt worden war, blieben doch die meisten Katholen. An Gott glaubten sowieso alle. Es war eine Zeit ausgeprägter Frömmigkeit, und im Allgemeinen wurde das Leben als Jammertal angesehen, das durchwandert werden will, bevor das eigentliche Leben beginnt. Umso ausgeprägter war der Pragmatismus, mit dem die meisten durch dieses irdische Jammertal streiften. Es wurde kräftig umverteilt, und die Mainzer gaben, was sie zu geben hatten, um ohne Plünderung und Brandschatzung davon zu kommen. Gustav Adolf suchte sich ein paar schöne Weihnachtsgeschenke aus, die er im Dom fand. Einige Stücke davon kann man in Museen in Uppsala anschauen.
Was bleibt von einem blinden alten Mann, dessen Schicksal sich auf dem Wasser wiederholt? Er starb auf dem zugefrorenen Wasser des Rheins und fand sein endgültiges Ende auf dem Grund der Ostsee. Eine einzige Beschreibung ist überliefert und sie stammt von Joachim von Sandrart, die er in seinem Werk „Teutsche Academie der Edlen Bau- Bild- und Malerey-Künste“ um 1675 veröffentlichte:
„Ferner waren von dieser edlen Hand zu Mainz in dem Dom auf der linken Seiten des Chors, in drey unterschiedlichen Capellen, drey Altar-Blätter, jedes mit zweien Flügeln in- und auswendig gemalt gewesen, deren erstes war unsere liebe Frau mit dem Christkindlein in der Wolke, unten zu Erden warten viele Heiligen in sonderbarer Zierlichkeit auf, als S. Catharina, S. Barbara, Caecilia, Elisabetha, Apollonia und Ursula, alle dermaßen adelich, naturlich, holdselich und correct gezeichnet, auch so wol coloriert, das sie mehr im Himmel als auf Erden zu seyn scheinen. Auf ein anderes Blat war gebildet ein blinder Einsiedler, der mit seinem Leitbuben, über den zugefrornen Rheinstrom gehend, auf dem Eiß von zween Mördern überfallen, und zu todt geschlagen wird, und auf seinem schreyenden Knaben ligt, an affecten und Ausbildung mit verwunderlich wahren Gedanken gleichsam überhäuft anzusehen; das dritte Blat war etwas imperfecter, als vorige zwey und sind zusammen Anno 1631. Oder 32. im damaligen wilden Krieg weggenommen, und in einem Schiff nach Schweden versandt worden, aber neben vielen anderen dergleichen Kunststücken durch Schiffbruch in dem Meer zu Grund gegangen …“
Die „edle Hand“ des von Sandrarts beschriebenen, gehörte zu einem der bekanntesten unbekanntesten Künstlern in Deutschland: Matthias Grünewald. Dass er eigentlich ganz anders hieß, ist eine andere Geschichte. Mit den Mainzer Altären, die fast die Hälfte des bekannten Werkes von Grünewald ausmachten, sind wohl 15 Bildtafeln auf dem Grund der Ostsee verrottet. Wer den Isenheimer Altar von Grünewald in Colmar kennt, und die meisten werden bewusst oder unbewusst schon einige Bilder davon gesehen haben, könnte Gustav Adolf noch nachträglich in den Hintern treten, weil er sich dieses Weihnachtgeschenk ausgesucht hatte.
Erst im August dieses Jahres hat eine tapfere badische Wirtin mit dem Namen Nadine Schellenberger den Mut gehabt, einmal Carl XVI Gustaf, amtierender Schwede, für das Tun seiner Vorfahren in die Schranken zu verweisen. Esst eure Pizza woanders, wir haben voll. So oder so ähnlich verweigerte sie dem König den Eintritt in ihre Gaststube in Ladenburg. Ob sie ihn weiter nach Mainz schickte, zum Essen oder um Abbitte zu leisten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Text: Dieter Motzel 2011
 haushundhirsch
haushundhirsch





























